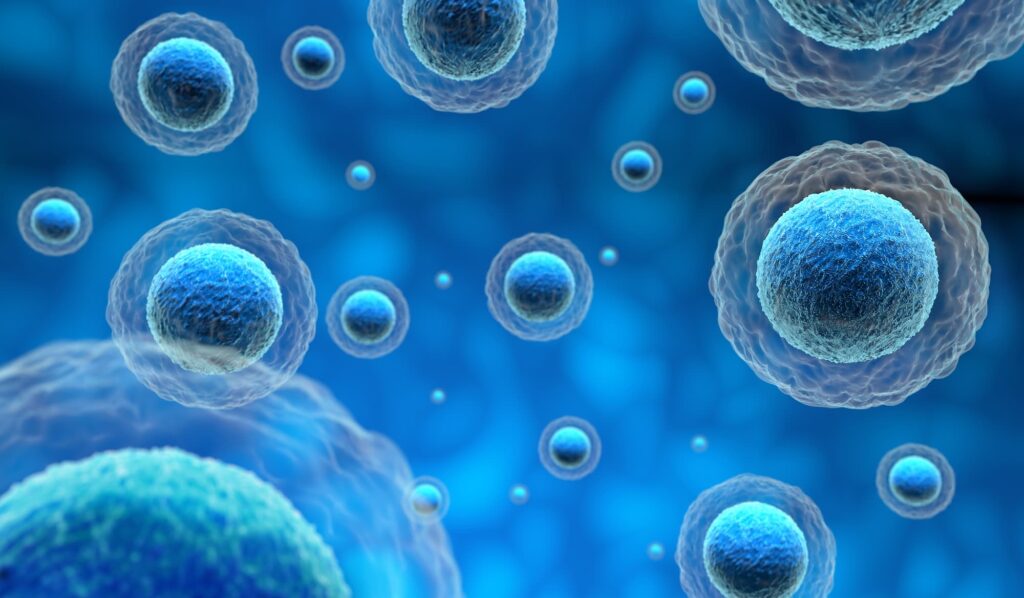Dr. Fiona Maas, Dr. Anneke Spoorenberg, Dr. Boukje P. G. van der Slik, Dr. Eveline van der Veer, Dr. Elisabeth Brouwer, Dr. Hendrika Bootsma, Dr. Reinhard Bos, Dr. Freke R. Wink und Dr. Suzanne Arends, Universität Groningen und Medizinzentrum Leeuwarden, Niederlande
Wirbelbrüche können zu starken Rückenschmerzen, zu eingeschränkter Wirbelsäulenbeweglichkeit, Körperlängenverlust und Behinderung führen. Vorhandene Wirbelbrüche erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu weiteren Wirbelbrüchen und sogar zu Knochenbrüchen ausserhalb der Wirbelsäule kommt.
Bei Morbus-Bechterew-Patienten ist das Risiko, einen Wirbelbruch zu erleiden, um den Faktor 2 bis 8 höher als bei Menschen ohne Morbus Bechterew. Frühere Studien ergaben, dass 10 % bis 43 % der Morbus-Bechterew-Patienten mindestens schon einmal einen Wirbelbruch erlitten hatten.
Häufig als Schub fehlinterpretiert
Häufig bleiben Wirbelbrüche unerkannt, entweder weil sie keine zusätzlichen Schmerzen verursachen oder weil die Schmerzen als Entzündungs-Schub fehl-interpretiert werden, oder weil Wirbelbrüche in normalen Röntgenaufnahmen oft schwer zu erkennen sind. Geringfügige Wirbelbrüche im mittleren Brustwirbelsäulenbereich sind in Röntgenaufnahmen besonders schwer von anderen Wirbelsäulenveränderungen zu unterscheiden.
Bei früheren Untersuchungen wurde festgestellt, dass männliches Geschlecht, längere Krankheitsdauer, Rauchen, geringe Wirbelsäulenbeweglichkeit (insbesondere bei verkrümmter Wirbelsäule) und geringe Knochendichte mit einem höheren Wirbelbruch-Risiko verknüpft sind.
Wenig ist bekannt über die Häufigkeit neuer Wirbelbrüche innerhalb eines bestimmten Zeitraums und ob Medikamente darauf einen Einfluss haben. In einer koreanischen Studie von 2014 wurde festgestellt, dass innerhalb von zwei Jahren 5 % und innerhalb von vier Jahren 14 % der Patienten allein in der Lendenwirbelsäule einen Wirbelbruch erlitten. In unserer Studie von 2016 an Patienten, die mit TNF-Blockern behandelt wurden, hatten 20 % innerhalb von vier Jahren einen neuen Wirbelbruch in der Lenden- oder Brustwirbelsäule.
Zwei Drittel waren milde Frakturen
Ziel unserer neuen Studie war, bei Bechterew-Patienten die Häufigkeit neuer Wirbelbrüche in Abhängigkeit von Patienten-Charakteristiken, medizinischen Befunden und der Behandlung mit Medikamenten zu erforschen. Dazu massen wir die Höhe der Wirbelkörper zwischen dem 4. Brustwirbel und dem 4. Lendenwirbel. Eine Höhenreduktion irgendeines Wirbels um mindestens 20 % rechneten wir als Wirbelbruch. Wir bezeichneten die Fraktur als mild bei einer Höhenreduktion um 20–25 %, moderat bei einer Höhenreduktion um 25–40 %, schwer bei einer Höhenreduktion um mehr als 40 %. Ausserdem wurde die Form des Wirbelbruchs dokumentiert.
Von den 292 Morbus-Bechterew-Patienten, von denen geeignete Röntgenaufnahmen vorlagen und die damit in die Studie eingeschlossen werden konnten, wurden 63 % wegen ihrer hohen Krankheitsaktivität mit TNF-Blockern behandelt. Wie zu erwarten, hatten diese Patienten auch häufiger eine Beteiligung peripherer Gelenke, eine geringere Wirbelsäulenbeweglichkeit, einen höheren Versteifungsgrad (höheren mSASSS) und eine geringere Knochendichte.
20 % der Studienteilnehmer hatten schon bei der Aufnahme in die Studie (Beginn der Beobachtungsdauer) mindestens einen Wirbelbruch. Von diesen Wirbelbrüchen konnten 70 % nach den oben erwähnten Kriterien als mild eingestuft werden, 28 % als moderat und 2 % als schwer. Die schweren Wirbelbrüche waren bei zwei älteren Patientinnen mit geringer Knochendichte aufgetreten, die schon vorher zwei unerkannte Wirbelbrüche erlitten hatten. Auch die übrigen Wirbelbrüche waren fast alle nicht erkannt worden.
Besonders häufig bei starker Wirbelsäulenkrümmung
Risikofaktoren für diese bereits vorhandenen Wirbelbrüche waren höheres Alter, Übergewicht, Rauchen, grösserer Kopf-Wand-Abstand, höherer Versteifungsgrad (mSASSS), geringere Knochendichte und seltenerer Gebrauch von nichtsteroidalen Antirheumatika. Bei Patienten, die zu Studienbeginn keine nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) einnahmen, waren Wirbelbrüche häufiger (31 %) als bei Patienten mit NSAR-Gebrauch (18 %). Besonders häufig (44 %) waren Wirbelbrüche bei Patienten mit einem Kopf-Wand-Abstand von mehr als 10 cm.
Während der zweijährigen Beobachtungsdauer erlitten 6 % der Patienten einen oder mehrere neue Wirbelbrüche. Der einzige als schwer eingestufte neue Wirbelbruch trat bei einer der beiden Patientinnen auf, die schon vor Studienbeginn einen schweren Wirbelbruch hatten.
Risikofaktoren für einen neuen Wirbelbruch waren wiederum höheres Alter, geringere Knochendichte sowie kein NSAR-Gebrauch zu Studienbeginn. Zwischen Patienten, die wegen der hohen Krankheitsaktivität mit TNF-Blockern behandelt wurden, und denjenigen, die trotz ihrer hohen Krankheitsaktivität konventionell behandelt wurden, scheint es keinen Unterschied in der Fraktur-Häufigkeit zu geben.
Rauchen und Übergewicht erhöhen Risiko
Diese umfangreiche Studie an Morbus-Bechterew-Patienten mit unterschiedlicher Krankheitsaktivität und unterschiedlicher Behandlung ergab, dass 20 % der Patienten bereits zu Studienbeginn einen im Röntgenbild feststellbaren Wirbelbruch aufwiesen, dass innerhalb von nur 2 Jahren 6 % der Patienten einen neuen Wirbelbruch erlitten und dass die meisten dieser Wirbelbrüche als mild einzustufen waren, mit einem Höhenverlust des betroffenen Wirbels um 20–25 %.
Ein wichtiges neues Ergebnis unserer Studie ist der Einfluss des Lebensstils (Rauchen und Übergewicht). Bechterew-Patienten, die 20 Jahre lang rauchten, haben ein doppelt so hohes Wirbelbruch-Risiko als Nichtraucher. Der von uns beobachtete Einfluss des Übergewichts kann damit zusammenhängen, dass eine geringere körperliche Aktivität zu einer geringeren Knochenqualität und auf diese Weise zu einem höheren Frakturrisiko führt.
Das interessanteste Ergebnis unserer Studie ist, dass der NSAR-Gebrauch das Fraktur-Risiko mindert, nicht jedoch eine Behandlung mit TNF-Blockern. Wie es zu diesem Einfluss des NSAR-Gebrauchs kommt, ist jedoch nicht klar.
Bei Verdacht immer CT oder MRI
Da Wirbelbrüche im Röntgenbild leicht übersehen werden, sollte bei einem Verdacht auf einen Wirbelbruch, insbesondere bei Patienten mit erhöhtem Wirbelbruch-Risiko, immer ein Computertomogramm oder ein Magnetresonanzbild angefertigt werden.
Maas, Fiona, et al. «Clinical risk factors for the presence and development of vertebral fractures in patients with ankylosing spondylitis.» Arthritis care & research 69.5 (2017): 694-702.
Quelle: «Morbus-Bechterew-Journal» Nr. 152 / März 2018